Kolumne Dezember 2019
Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage!
Es ist schon eine kleine Tradition, dass in der Friedenskirche im Dezember das „Weihnachtsoratorium“ (BWV 248) von Johann Sebastian Bach zu hören ist. Frieder Lang, ehemals selbst Mitglied des Dresdener Kreuzchores, Opernsänger und Münchener Professor für Gesang mit einem Faible für die Ökumene beschert es uns seit nunmehr drei Jahren. Und er belegt damit Jahr für Jahr, dass gemeinsames Singen alle Menschen zusammenbringen kann, mögen sie sonst auch einmal um die Rechtgläubigkeit anderer besorgt sein, weil die nicht aus dem gleichen Stall kommen und folglich gar nicht lutherisch oder katholisch, nicht evangelikal oder freikirchlich sind. Am Weihnachtsoratorium möge man bitte erkennen, was und vor allem wer alles zur höheren Ehre Gottes zusammengehört.
Und damit inszeniert Frieder Lang durchaus das Weihnachtsoratorium selbst in präziser Weise. Die insgesamt sechs einzelnen Teile des Werkes wurden zum ersten Mal am Jahreswechsel 1734/35 in den sechs Gottesdiensten ab dem ersten Weihnachtsfeiertag bis zum 6. Januar in zwei Leipziger Kirchen aufgeführt. Das Evangelium der Weihnachtsgeschichte (Lukas, Kapitel 2, und Matthäus, Kapitel 2) wird im Oratorium in 17 Abschnitte eingeteilt. Die Notwendigkeit dieser Summe ergibt sich aus den Zahlen 10 (Gebote) und 7 (Worte Jesu am Kreuz). Die ersten vier Teile mit ihren zehn Abschnitten behandeln Persönlichkeiten aus dem Volk Israel, die Teile V und VI mit sieben Evangelienstücken drehen sich um die so genannten „Weisen aus dem Morgenland“. Bach bindet alle Teile durch die wiederholte Verwendung der Tonart D-Dur (Teile I, III und VI) zusammen, in denen zudem immer dieselbe festliche Besetzung mit Trompeten, Pauken, Holzbläsern und Streichern zu hören ist.
Den Anfang in Teil I macht das Orchester mit drei Trompeten, zwei Pauken, zwei Traversflöten, zwei Oboen, den Streicherinnen und Streichern und dem Continuo (Cello, Violone, Or-gel, Fagott). Und der Chor folgt sogleich, um die Geburtsgeschichte Jesu in Schwung zu bringen. Bach eröffnet das Oratorium wie die meisten seiner Kantaten mit einem solchen Chor. Die lauschende Aufführungsgemeinde wird durch das „Jauchzet, frohlocket“ unmittelbar motiviert, das folgende Geschehen auf sich zu beziehen: „rühmet, was heute der Höchste getan“. Die lukanische Weihnachtsgeschichte beginnt ja damit, dass Maria und Joseph aufgrund einer Volkszählung in Syrien gezwungen wurden, ihre Heimat ganz in Norden Israels, in Galiläa, zu verlassen und sich in Josephs Geburtsort im Süden des Landes, in Bethlehem, in die amtlichen Steuerlisten einzutragen. Diese äußere Bewegung nimmt der Solo-Art auf und verwandelt sie in der Arie „Bereite dich, Zion“ in eine innere Sehnsucht. Durch äußere und innere Impulse sollen wir von Anfang an eine Ahnung von der Größe des Bevor-stehenden bekommen …
Leider gibt es von Frieder Langs Interpretation des „Weihnachtsoratoriums“ noch keine eigene Einspielung, um sie sich nach dem 5. Dezember einen ganzen Monat lang immer wieder anzuhören. Wer den Vorteil hatte, bei der Aufführung in diesem oder in einem der letzten beiden Jahre dabei zu sein, trägt aber gewiss den Eindruck im Herzen weiter, wie berührend es klingt, wenn uns mit allen Mitteln der Kunst davon erzählt wird, dass Gott uns zugut auf Erden zur Welt gekommen ist, um uns hier sehr menschlich zu begegnen.
Pfarrer Dr. Stefan Koch
Kolumne Oktober 2019
Die Schallplatte – mehr als Nostalgie
 Foto von Kevsphotos auf Pixabay
Foto von Kevsphotos auf PixabayEs ist Herbst. Die Zeit, in der man gerne im Haus bleibt, aufräumt, sortiert. Es ist die Zeit der Flohmärkte, wo sich altes, nicht mehr gebrauchtest sammelt und den Besitzer wechselt. Der Reiz liegt in den Gegenständen, die gerade nicht nötig sind, längst durch anderes ersetzt wurde, die aber ein Gefühl der Nostalgie, der Erinnerung auslösen.
So wie die Schallplatte. Sie ist fast schon ein Relikt, auf jeden Fall ein Gruß aus einer anderen Zeit. Kinder kennen kaum noch die Schallplatte, sondern nur noch die kleinen handlicheren CDs. Erinnerung: sorgfältige Behandlung, nicht hineinfassen, möglichst wenig Hautkontakt.
Auf den Flohmärkten gibt es sie noch in großen Mengen, oftmals ohne Hülle. So stehen sie da, wie nackt.
Es geht eine Faszination von den schwarzen Scheiben aus: alle sehen sie gleich aus, man weiß nicht, was die Spuren, eingegraben in diese Platte, beinhalten.
Ist es eine aufwühlende Oper von Richard Wagner oder die kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart?
Ist es eine Rede, aufgenommen auf einem freien Platz mit viel Hintergrundgeräusche oder ein Märchen mit verteilten Rollen?
Manchmal sieht man Kratzspuren und weiß, hier wird die Nadel springen so wie bei meinem eigenen Schallplatten aus der Kindheit und Jugend, die ich so oft gehört habe, dass mir auch jeder Rillensprung vertraut war.
Um das Geheimnis zu lüften, das sich hinter dem Fundstück verbirgt, muss ich es anhören. Nicht immer gefällt mir, was ich höre, aber immer wieder werde ich auf diese Weise in eine andere Zeit hineingenommen, manchmal sogar in ein anderes Leben. Auf diese Weise habe ich schon so manche Kostbarkeit gefunden – nicht im materiellen Sinn, aber Momente besonderer Tiefe oder Freude.
Die Schallplatte ist für mich ein Bild für unser Leben. Wir alle tragen Spuren, die uns zu dem machen, was wir sind: Melodien all der schönen Erlebnisse, die wir machen konnten: in der Natur, mit einem geliebten Menschen, mit der Familie, mit einem guten Buch. Da sind aber auch aufwühlende, aggressive, beängstigende Töne, die gleichberechtigt ihre Spur ziehen. Gleichmäßig läuft der Tonarm über all die Höhen und Tiefen und bringt sie durch seine Berührung zu Gehör. So wie Schallplatte ihren Sinn darin entfaltet, dass sie das, was ihr eingeprägt wurde, erklingt, so brauchen wir als Menschen ebenfalls das Interesse, das offene Ohr, das uns ermutigt, unsere Lebensmelodien preiszugeben. Auch mit den Kratzern, die so manche Passage durchkreuzen.
Und auch dies ist der Schallplatte eigen: Ich kann mich erinnern, wie ich als Kind fasziniert zugeschaut habe, wie der Tonarm konsequent auf die Mitte zugelaufen ist, sich dann gehoben hat und sich wieder auf die Vorrichtung gelegt hat, bis ich ihn wieder vorsichtig auf den äußersten Rand aufgesetzt habe.
Das Konzert, die Geschichte ist dann fertig, wenn die Mitte erreicht ist. Das ist ein durchaus christliches Symbol. Es erinnert mich an das Labyrinth und an den Weg darin, der – im Gegensatz zum Irrgarten – immer zum Ziel führt.
Gerade im Ziel blicken wir nicht nur zurück und betrachten unser Leben, das was war und uns geprägt hat, sondern blicken auch nach vorne, auf das Ziel, das zugleich Sinn ist. Der christliche Glaube verheißt uns, dass unsere Lebensmelodie nicht abbricht, sondern dass wir zur Mitte finden, zu uns selbst, zu Gott. Und zwar mit allem, was wir bis dahin an spitzen und sanften, hohen und tiefen Tönen, an vollen und lauten, ebenso wie an zarten und zurückhalten Tönen erfahren haben.
Es ist aber nicht nur die Verheißung, sondern vor allem die Einladung, das, was wir täglich in unserem Herzen tragen, vor Gott zu bringen, dessen Ohr für uns geöffnet ist.
Lesung: aus: Jes 43:
1. Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!
2. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen.
3. Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland.
4. weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. AMEN
Mit freundlichen Grüßen
Pfarrerin Birgit Reichenbacher
Kolumne September 2019
Winterwetter – Spinnenflug
Unter den Wetterpropheten ist der September einer der besten. Kirchliche oder staatliche Feiertage hat der Monat nicht zu bieten. Aber jede Menge Wetterregeln sagten früher voraus, wie der kommende Winter und sein Schneefall sein würden, indem sie den September in die Pflicht nahmen. Immerhin ist Michaelis, der 29. September, einer der Los-Tage im Jahr, so wie die bekannteren Termine an Lichtmess (2. Februar), Johanni (24. Juni) und Siebenschläfer (27. Juni). Von den sogenannten „Los-“ oder „Geschick-Tagen“ leitete die traditionelle Landwirtschaft früher die Arbeitsplanung der kommenden Wochen und der anstehenden Ernten ab. Offensichtlich sind diese Tage auch mit Wetterumschwüngen verbunden …
„Donnert es im September noch, wird der Schnee um Weihnacht hoch.“
„Viel Nebel im September über Tal und Höh‘ bringt im Winter tiefen Schnee.“
„Viel Eicheln im September, viel Schnee im Dezember.“
„Wenn Bucheckern geraten wohl, Nuss- und Eichbaum hängen voll, so folgt ein harter Winter drauf, und es fällt der Schnee zuhauf.“
In der Brauchtumsreligion galten zudem der 15. und der 18. September als sogenannte „Schwendtage“, an denen man besser nichts Neues beginnen sollte. Besonders unglücklich wäre angeblich der 30. September. So ein Tag eigne sich trefflich zum Unkrautjäten, Ausmisten und Putzen. Pech irgendwie, dass er in diesem Jahr auf einen Montag fällt …
Die moderne wissenschaftliche Meteorologie kann – sofern der Klimawandel und die Wetterverschiebungen es noch zulassen – begründetere Aussagen abgeben, die den September und sein Wetter oft genug auch wirklich treffen. Langjährige Beobachtungen machen wahrscheinlich, dass es Anfang September noch einmal warm sein wird, ab Mitte des Monats kühlere Witterung vorherrscht und erst ab Ende September wieder ein stabiles Warmwetter zu erwarten bleibt, das traditionell „Altweibersommer“ genannt wird. Der Name soll sich (so die unterhaltsamste der im Netz kursierenden Erklärungen) von den Fäden herleiten, mit denen junge Baldachinspinnen im Herbst durch die Luft segeln. Der arachnide Flugfaden erinnere angeblich an das graue Haar alter Frauen. Das lässt die Vermutung zu, dass alte Männer damals ihre grauen Haare entweder nicht offen getragen oder tatsächlich auch schon gschamig gefärbt haben …
Angeblich bringt es Glück, wenn ein solcher Faden an der Kleidung hängen bleibt. Wer ihn mit sich herumträgt, würde berühmt werden, hieß es zum Trost. Vorsicht also, wenn Sie jemandem ein angebliches Haar von den Schultern der Jacke oder des Anzugs streifen wollen, womöglich geht dadurch eine zukünftige Zelebrität ihres ausstehenden Ruhms bis auf weiteres erst einmal verlustig …
Pfarrer Dr. Stefan Koch
Kolumne August 2019
Himmelsstürmer
Auf dem Vorplatz des Kulturbahnhofs in Kassel steht eine Skulptur. Sie stammt von dem US-Amerikaner Jonathan Borofsky. Der Titel seines Kunstwerks lautet „Man walking to the sky“, als deutsche Übersetzung hat sich der Begriff „Himmelsstürmer“ durchgesetzt. Das Kunstwerk hatte Borofsky 1992 für die documenta IX – eine großangelegte Kunst-und Medienausstellung, entworfen. Sie besteht aus einer Stahlröhre von 25 Metern Höhe und 50 Zentimetern Durchmesser. Die Röhre ist mit einem Neigungswinkel von 63° aufgestellt. Sie trägt ungefähr am Beginn des letzten Drittels eine bemalte Fiberglasfigur. Diese wiederum zeigt einen Mann in violettem T-Shirt und gelber Hose. Mit zügigen und zugleich leichten Schritten scheint er nach oben, einem unbekannten Ziel entgegen zu gehen. Die Figur vermittelt den Eindruck, dass weder Angst vor einem Sturz aus dieser großer Höhe noch die Gesetze der Schwerkraft den Menschen zurück halten können. Er scheint tatsächlich ein richtiger „Himmelsstürmer“ zu sein. Diese Skulptur ist ein Bild voller Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit.. Es ist ein Mut-Mach-Kunstwerk, das auch heute wieder, auf dem Hintergrund vieler Ängste, besonders zur Wirkung kommt: Die Menschen, die sich am Fuß der Skulptur versammeln und nach oben blicken, fragen unwillkürlich: Wie wäre es, wenn ich diese Figur wäre? Ist es möglich, den Gesetzten unserer Welt zum Trotz und angesichts aller Ängste, auch mein ganz eigenen, etwas zu wagen? Was lässt mich die richtige Balance finden, was hilft, nicht ängstlich auf die Gefahr nach unten zu schauen, sondern den Kopf nach oben zu richten? Die Antworten auf solche Fragen soll sich, so ist das Anliegen des Künstlers, der Betrachter selbst geben. Mir fallen dazu biblische Geschichten ein, die ähnliche Bilder aufnehmen. So wie die aus dem 1. Buch Mose, dem 28. Kapitel: Hier wird erzählt, wie Jakob, nachdem er seinen Bruder Esau um dessen Erstgeburtsrecht betrogen hat, fliehen muss. Ich lese die sich anschließenden Verse:
„Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen.
Und ihn träumte und siehe eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder.
Und der Herr stand oben darauf und Sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen sollen Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.
Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Führwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht!
Und er fürchtete sich und sprach; Wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels.
Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahem den Stein, der er zu seinen Haupten gelegt hatte, und richte ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl darauf und nannte die Stätte Bethel.“
Die folgenden Kapitel erzählen von dem langen, oft gefährlichen, schmerzhaften und mühsamen Weg, den Jakob geht. Tatsächlich ist dieser Weg oft eine Gradwanderung zwischen Erfolg und Untergang. Es ist eine Geschichte des ständigen Aufbruchs, der Überwindung von Angst, aber auch von Gewohnheit. Es ist ein ständiges sich Einlassen auf neue Lebensabschnitte, auf eine veränderte Welt. Aber Jakob geht ihn weiter und sieht am Ende seines Lebens die Verheißung Gottes an ihm, den Schalom, den inneren Frieden, erfüllt. Was ihn und unzählige Generationen nach ihm ermutigt und gehalten hat, das ist der Zuspruch Gottes, nicht von seiner Seite zu weichen. In jeder Minute, in der wir uns diesen Zuspruch vergegenwärtigen, ist Gott ganz nahe, da berühren Himmel und Erde. In einem modernen Lied wird dieser Gedanke schön aufgenommen.
„Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen, und neu beginnen, ganz neu. Da Berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns.
Wo Mensch sich verschenken, die Liebe bedenken, und beginnen ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.
Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.“
Mit freundlichen Grüßen
Pfarrerin Birgit Reichenbacher
Kolumne Juli 2019
„Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn.“
Monatsspruch für den Juli aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1 Vers 19
In diesem Jahr warten nach den spannenden Fußballturnieren, dem Tennis in englischen Wimbledon und den Rennfahrern der Tour de France keine Olympischen Spiele auf uns, sonst wäre dieser Zusammenhang meine erste Idee gewesen. Der Bibelvers aus dem Jakobusbrief im Neuen Testament wirkt zunächst wie die umgekehrte Devise „schneller – höher – stärker“ (vom lateinischen citius, altius, fortius). Als die olympischen Spiele der Neuzeit geplant wurden, hatte Pierre de Coubertin die Redewendung, die er bei einem französischen Schulsportfest zum ersten Mal selbst hörte, in der Schlusssitzung des Gründungskongresses des IOC (Internationales Olympisches Komitee) im Jahr 1894 als Motto vorgeschlagen. Es dauerte freilich noch 30 Jahre, bis der Satz bei den Pariser Spielen 1924 dann auch verwendet wurde.
Statt der steten Steigerung rät der Jakobusbrief zur spürbaren Entschleunigung. Unser Hören geht schnell. Unser Reden folgt darauf meist zu schnell. Und das, was wir manchmal damit anrichten, kann dazu führen, dass unvermittelt die nächsten hitzigeren Worte folgen. Das „schnell, langsam(er), langsam“ im Brief ist aber auch eine inhaltliche Steigerung. Es achtet auf die Wirkung unserer Kommunikation und will befrieden, was wir sagen, damit es nicht zum unkontrollierten Zorn eskaliert.
Der Jakobusbrief ist ein Schreiben, das noch um die jüdischen Wurzeln des Christentums weiß. Fachleute vergleichen den Brief gerne mit der Bergpredigt Jesu, die im Matthäusevangelium in den Kapiteln 5 bis 7 aufgeschrieben ist. Und auch andere jüdische Texte aus dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung haben diese Perspektive stets im Blick. So steht in den „Testamenten der 12 Patriar-chen“, einer fiktiven Sammlung des Nachlasses der Namenspatrone der 12 Stämme des Volkes Israel, diese Warnung als die Wichtigs-te am Schluss: Hüte dich davor, Menschen zornig zu machen. Vermeide den eigenen Zorn, so gut du kannst. Wenn es nötig ist, tritt lieber auch dann einen Schritt zurück, wenn du eigentlich im Recht bis (so etwa im „Testamentum Levi“, TestLev 15,3). Der Zorn ist nämlich in der Bibel das Vorrecht Gottes.
Und das ist sicher auch ein beherzigenswerter Hinweis für unseren Sommer: Tritt auf die Bremse beim Zorn. Wenn es dir gegeben ist, spare dir die Widerworte. Und wo es geht, höre erst gut zu, überhöre – wenn nötig – das Freche, das dir darin vermutlich begegnet, so viel du es vermagst, und antworte möglichst nicht mit gleicher oder schrillerer Tonlage. Diese Mahnung richtet der Jakobusbrief an alle Menschen, wir können sie also auch allen Menschen gegenüber beherzt anwenden …
An Feldern, die sich für einen Langzeitversuch an der eigenen Geduld eignen, mangelt es uns vor Ort gewiss nicht. Noch auf der kürzesten Strecke mit dem Mofa unterwegs durch die Gemeinde hin zu den Menschen habe ich fast täglich Gelegenheit, als Klügerer (und Schwächerer) nachzugeben oder den Rad Fahrenden oder zu Fuß gehenden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs-teilnehmern freundlich zu begegnen. Auch wenn die antiolympische Devise aus dem Jakobusbrief kein ausdrücklich christlicher Leitsatz ist, an dem man uns in der Öffentlichkeit erkennen sollte, zur Haltung darf er auch uns werden. Wir werden keinen gewohnheitsmäßigen Raser oder aktuell einigen Drängler dadurch „bekehren“ oder auch nur zum Nachdenken bringen. Aber wenn mir unterwegs die frische Luft der kommunikativen Freundlichkeit um die Nase weht, tut mir das ja immer auch mir selbst gut.
Pfarrer Dr. Stefan Koch
Kolumne Juni 2019
Pfingsten – das Fest der „Schubumkehr“
 Der frühere Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, hat in einer Predigt in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin das Pfingstfest einmal mit der Erfahrung der Schubumkehr verglichen. Schubumkehr – das ist die Umkehr der Kraft, die ein Flugzeug zu leisten hat, wenn es zum Anflug ansetzt. Wenn die Beschleunigung in eine Bremskraft verwandelt wird.
Der frühere Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, hat in einer Predigt in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin das Pfingstfest einmal mit der Erfahrung der Schubumkehr verglichen. Schubumkehr – das ist die Umkehr der Kraft, die ein Flugzeug zu leisten hat, wenn es zum Anflug ansetzt. Wenn die Beschleunigung in eine Bremskraft verwandelt wird.
Als Passagier merkt man meist erst zu dem Zeitpunkt, wenn der Sicherheitsgurt einen zurückhält, in welch großer Geschwindigkeit das Flugzeug geflogen und was es bedeuten würde, wenn eben diese Schubumkehr ausbleiben würde.
Pfingsten ist ein Fest der Schubumkehr. Auch wenn dieses Wort in der Bibel noch nicht vorkommen kann und die Autoren vielleicht auch diesen Vergleich nicht gewählt hätten. Immer wieder aber ist von einer Umkehr die Rede. Umkehr vom rasenden Weg ins Verderben zu einem neuen Anfang. Umkehr des ängstlichen Sich-Verkriechens der Jünger zu einem mutigen Auftritt des Petrus vor der Menge in Jerusalem. Umkehr von der babylonischen Sprachverwirrung zur Verständigung der Völker.
Diese Schubumkehr beschreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Korinth, wo er von den verschiedenen Geistgaben spricht. Dabei unterscheidet Paulus zwischen dem Geist der Welt und dem Geist aus Gott. Er unterscheidet Torheit vom Dank. Es ist, als würde Paulus durch dieses Unterscheiden Denksperren beiseite räumen wollen, die sich seine Gesprächspartner auferlegt haben – z.B.. die Denkfigur, dass der Glaube von besonderen religiösen Genen abhängt, die man hat oder nicht hat. Oder die Denkfigur, nur der glaube, der das Datum seiner Bekehrung nachweisen könne. So als ob der Glaube nicht ein langer Weg sein kann, bei den sich die Klarheit plötzlich am Horizont zeigt, ohne dass ich genau sagen kann, seit wann sie in mein Blickfeld getreten ist.
Pfingsten gehört zu den großen Festen im Kirchenjahr. Und auch wenn Weihnachten und Ostern anschaulicher und greifbarer sind und deshalb mit viel mehr Brauchtum ausgestattet, ist Pfingsten doch nicht weniger bedeutsam. Denn diese Kraft, die Umkehr möglich macht, eröffnet neue Lebensmöglichkeiten.
Ein Leben lang sind wir mit den großen Fragen beschäftigt: Warum bin ich auf dieser Welt? Wem kann ich trauen? Auf was kann ich mich verlassen? Warum trifft es mich? Auf der Suche nach Antworten brauchen wir die Kraft, die Geister zu unterscheiden. Wir brauchen diesen Geist, damit wir nicht versinken in einen Geist des Kleinmuts, der wechselseitigen Abgrenzung und der Resignation.
In der Apostelgeschichte wird das Pfingstereignis mit Feuerflammen verglichen, die sich auf die Häupter setzen. Nicht nur auf das von Petrus, sondern auf jeden einzelnen und doch auf die Gemeinschaft. Auch das ist Pfingsten: Das Bewusstwerden, dass christlicher Glaube keine Privatsache ist, sondern Gemeinschaft stiftet und erhält. Keiner glaubt für sich alleine. Wir stehen auf den Schultern derjenigen, die vor uns geglaubt haben. Wir halten die Hände derer, die mit uns glauben. Und wir bieten hoffentlich auch die Schultern für diejenigen, die nach uns glauben wollen. So sind wir als glaubende Gemeinschaft, als Christi in Christi Sinn eine Verantwortungsgemeinschaft für das, was hilft, die Geister, auch die Geister der Zeit zu unterscheiden. Und wenn es sein muss, auch einzuschreiten, wenn Unrecht geübt wird – sei es im Kleinen einer Wohngemeinschaft, einer Kirche oder gegenüber Menschen in einem anderen Land dieser Welt.
Diesen Geist haben wir als Menschen nötig. Und um diesen bitten wir immer wieder. Ich schließe mit einem Gebet von Sylke-Maria Pohl:
Gott, guter Vater,
bei jedem Gefühl der Verlassenheit
begleite mich durch DEINEN HL. GEIST,
bei jedem Gefühl der Einsamkeit,
umarme mich durch DEINEN HL. GEIST,
bei jedem Gefühl der Schuld,
verzeihe mir durch DEINEN HL. GEIST,
bei jedem Gefühl der Schwäche,
stärke mich durch DIENEN HL. GEIST,
bei jedem Gefühl der Schmerzen,
heile mich durch DEINEN HL. GEIST,
bei jedem Gefühl der Trauer,
tröste mich durch DEINEN HL. GEIST
und bei jedem Gefühl der Freude freu DICH mit mir
DU HEILIGER GEIST GOTTES.
AMEN
Mit freundlichen Grüßen
Pfarrerin Birgit Reichenbacher
Kolumne Mai 2019
Wahres Leben ist Begegnung
Mit dem Mai verbindet sich traditionell viel Brauchtum. Aber es gibt auch ein paar Neuigkeiten. Bei den Euro-Banknoten wurden die Scheine mit dem Wert von 5, 10, 20 und 50 schon überarbeitet. Im Mai sind die 100er, 200er und 500er dran. Erst seit ich in Starnberg lebe und zur Bank gehe, bekomme ich solch große Scheine, wenn ich beim Abheben nicht auf die Stückelung achte. Wenn man die neuen Scheine in der Hand hin und her bewegt, ändert sich angeblich die Farbe der aufgedruckten Zahl. Und die 500er werden ganz abgeschafft, ohne ihre Gültigkeit zu verlieren. Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal einen solch großen Schein in der Hand gehabt zu haben. Auch bei der Kollekte oder im Klingelbeutel nicht. Wenn Menschen uns so viel Geld spenden, tun sie das eigentlich immer elektronisch …
Mitte Mai ändern sich die Kosten fürs Handy ins Ausland. Auf den Topf kommt endlich ein 19-Cent-pro-Minute-Deckel fürs Anrufen und eine 6-cent-pro-SMS-Haube aufs Getippe. Weil ich solche Dienste selten nutze, werde ich die angepriesene Kosteneinsparung von bis zu 80 % für die Kommunikation mit dem Ausland vermutlich kaum spüren. Ob das auch den handysüchtigen Mann, um den ich mir derzeit durchaus Sorgen mache, wie er von seiner Fixierung auf den kleinen Bildschirm loskommt, auf bessere Gedanken bringt?
Im Lauf des Monats soll ein neues Gesetz in Kraft treten, das den Schadstoffausstoß bei Autos neu reguliert – und vor allem Fahrverbote für Dieselmotoren verhindert. Also wir vor einiger Zeit ein neues Gemeindeauto angeschafft haben, das jetzt probeweise auch als Bürgerbus durch Starnberg kurvt, haben wir trotzdem darauf Wert gelegt, keinen Diesel mehr anzuschaffen. Und eigentlich möchte ich mein rotes Mofa jetzt auch endlich in ein e-Mofa umtauschen, damit wir zwei nicht mehr so stinken, wenn wir durch die Stadt knattern. Mit der normalen täglichen Batterieleistung sollte ich hin-kommen, nachts steht das gute Stück dann zum Laden in der Garage …
Und es gäbe noch viele weitere Neuheiten zu berichten. Dass endlich auch betreute behinderte Menschen an der Europawahl teilnehmen können, die Zeit für die Steuererklärung um zwei Monate verlängert wurde und der Mindestlohn für Maler und Lackierer bei Ungelernten auf 10,85 pro Stunde steigt, bei Gesellen in Westdeutschland auf 13,30 Euro und in Ostdeutschland auf 12,95 Euro. Die meisten dieser Nachrichten werden für Menschen erst relevant, wenn sie einen persönlichen Bezug dazu bekommen. Diesen halte ich tatsächlich auch für entscheidend. Hoffentlich gelingt Ihnen und mir in den kommenden Wochen auch die eine oder andere persönliche Begegnung bei bitte nicht nur traurigen Anlässen.
Pfarrer Dr. Stefan Koch
Kolumne April 2019
 Die Chance der Stille
Die Chance der Stille
Die Wochen in der Passionszeit werden sehr unterschiedlich genutzt. Während die einen schon mit der Planung für den bevorstehenden Osterurlaub beschäftigt sind, nehmen andere die Fastenzeit wahr, um Abstand vom Alltag und der Geschäftigkeit zu nehmen. Geschichten, die uns zum Nachdenken bringen, haben in der Zeit vor Ostern ebenso einen festen Platz wie in der Adventszeit. So wie folgende kleine Erzählung, dessen Autor mir leider nicht bekannt ist:
Eines Tages kamen zu einem einsamen Mönch einige Menschen. Sie fragten ihn: "Was ist der Sinn von Stille und Meditation, für die Du und Deine Brüder stehen?“ Der Mönch war gerade mit dem Schöpfen von Wasser aus einem tiefen Brunnen beschäftigt. Er sprach zu seinen Besuchern: "Schaut in den Brunnen. Was seht ihr?" Die Leute blickten in den tiefen Brunnen und antworteten: "Wir sehen nichts!" Der Mönch stellte seinen Eimer ab. Nach einer kurzen Weile forderte er die Leute noch einmal auf: "Schaut in den Brunnen! Was sehr ihr jetzt?" Die Leute blickten wieder hinunter: "Jetzt sehen wir uns selbst!" "Ihr konntet nichts sehen“ erwiderte der Mönch, „weil das Wasser unruhig war wie Euer Leben. Nun aber ist es ruhig. Das ist es, was uns die Stille schenkt: Man sieht sich selber!“ Dann gebot der Mönch den Leuten, noch eine Weile zu warten. Schließlich forderte er sie auf: "Und nun: Schaut noch einmal in den Brunnen. Was seht ihr?" Die Menschen schauten hinunter: "Nun sehen wir die Steine auf dem Grund des Brunnens." Da erklärte der Mönch: "Das ist die Erfahrung der Stille und der Meditation. Wann man lange genug wartet, sieht man den Grund aller Dinge."
Diese Geschichte macht deutlich: Stille ist nicht einfach „Abschalten“, und Meditation ist keineswegs Abkehr vom Leben. Um dem eigenen Leben auf der Spur zu bleiben, die eigenen Tiefen nicht aus dem Auge zu verlieren, um dann dem Leben wieder neu begegnen zu können, brauchen wir vielmehr bestimmte Bedingungen und den richtigen Rahmen. Ein solcher Rahmen ist die Fastenzeit. Sie lädt uns ein, zur Ruhe zu kommen und uns selbst ins Herz zu blicken. Wie dies genau geschehen kann, ist durchaus unterschiedlich. Während die einen sich gleich für einige Wochen in ein Kloster zurückziehen, wählen andere eine Form, die durch die Passionszeit begleitet. Dazu gehören auch die sogenannten „Exerzitien im Alltag“, ein Angebot, das in Starnberg auf ökumenischer Ebene angeboten und dankbar angenommen wird. Manchmal genügt aber auch schon eine Andacht, ein Psalm, ein Spaziergang, um die Wellen unseres Innenlebens zur Ruhe kommen zu lassen, so dass wir uns selbst wieder wahrnehmen und daraus die Zukunft entwerfen können.
Dass uns dies in den kommenden Wochen immer wieder gelinge möge, wünsche ich Ihnen und mir von Herzen,
Ihre
Pfarrerin Birgit Reichenbacher
Kolumne März 2019
Am 1. März hat für Meteorologen der Frühling begonnen. Wer es freilich mathematisch genau nimmt, sollte den Tag des Monats herausfinden, an dem die Nacht und der Tag exakt gleich lange dauern (die sogenannte „Tag-und-Nacht-Gleiche“). Würden wir in Starnberg am Äquator leben und nicht am 48. nördlichen Breitengrad (eine entsprechende Markierung findet sich am Trottoire an der Wittelsbacher Straße, Ecke Ludwigstraße), so könnten wir erleben, dass an diesem 20. März 2019 die Sonne hoch oben im Zenit steht, genau im Osten auf- und exakt im Westen untergeht. Uns betrifft diese astronomische Frage aber auch elementar im Hinblick auf den Ostertermin. Wir feiern schließlich das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten immer am Sonntag nach dem ersten Vollmond der Tag-und-Nacht-Gleiche, also dem ersten Frühlingsvollmond, der heuer am 19. April 2019, dem Karfreitag, am Nachthimmel zu sehen sein wird.
Mit dem dritten Kalendermonat (noch bei den Römern war der März der Erste im Jahr, was man an den Namen von September und Oktober ablesen kann) verbinden sich zahlreiche Bräuche und Texte. Einer davon ist das kurz nach 1900 zum ersten Mal in Schlesien belegte Bauernkalenderlied, dessen Melodiebeginn den ersten vier Takten von Wolfgang Amadeus Mozarts „Hafner-Symphonie“ (Köchelverzeichnis 250, entstanden in Salzburg 1776) entnommen ist:
Im Märzen der Bauer die Ochsen einspannt,
bearbeit‘ die Felder, besäet das Land,
er pflanzet und pelzet all Bäumlein im Land,
das bringet uns alle in fröhlichen Stand.
Das hiergezeichnete Landleben klingt idyllischer, als es damals oder jemals war und heute ist. Es wird als gründlich fröhlich und geradezu unbeschwert geschildert. Wir begegnen den Bauersleuten und einem fröhlichen Gesinde beim Pflügen, Eggen, Säen und Graben. In der zweiten Strophe geht es um die mühelos scheinende Pflege der Wiesen und die Veredelung der Bäume. Und die (spätere) dritte Strophe schaut dann schon auf die Ernte im Herbst und einen müßigen Winter zurück …
Dass die regionale Landwirtschaft so ungetrübt heiter und unbedarft nicht betrieben werden kann, haben die Diskussionen um das Volksbegehren zum Thema „Artensterben“ gezeigt. Wenn es im März dann an den Baumschnitt und die beginnende Gartenarbeit geht, sind wir alle aufgefordert, sorgsam und schützend mit der Natur umzugehen. Wäre es denkbar, deshalb das Gras im Kirchgarten neben der Friedenskirche in Starnberg in diesem Jahr anders zu mähen, die Hecken am Pfarrhaus vorsichtiger zu schneiden und dem großen Kirschbaum dort einen pflegenden, aber eben nicht zu radikalen Schnitt angedeihen zu lassen?
Das Bauernlied vom Märzen hatte in Deutschland eine eigenartige weitere Karriere. Die DDR vereinnahmte es im Liederbuch „Sing mit, Pionier“ (1972) mit einer heute zum Glück vergessenen vierten Strophe für „Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften“ (LPGs). Die Antiatombewegung im Westen nutzte es als Protestlied gegen Umweltverschmutzung.
Finden wir heute eine neue Form, der Natur als Gottes guter Schöpfung gerecht zu werden, ohne Idealisierung, ohne Vereinnahmung, ohne Ausbeutung und Missbrauch? Wir sollten damit vor der Haustür beginnen.
Pfarrer Dr. Stefan Koch
Kolumne Februar 2019
 Zum Valentinstag
Zum Valentinstag
Heute morgen kam eine junge Kollegin mit einem Strauß Blumen ins Lehrerzimmer. Richtig, dachte ich, heute ist ja Valentinstag. Überraschenderweise hat sie die Blumen aber von einigen Grundschüler bekommen – ein guter Anlass, gerade als Religionslehrer auf die Wurzeln des Brauchs zu schauen, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut:
Valentin, so berichten mittelalterliche Erzählungen, soll zur Zeit des römischen Kaisers Claudius II., also im 3. Jhd. n.Chr. in Rom als armer Priester gewirkt haben. Der Kaiser hatte von Valentin gehört. Er war so beeindruckt vom Wesen und von der Klugheit des alten Priesters, dass er gerne in einen freundschaftlichen Kontakt zu ihm getreten wäre. Was aber zwischen den Männern stand, das war der christliche Glaube von Valentin. Der Kaiser durfte es nicht hinnehmen, dass Valentin ihm die göttliche Huldigung verweigerte, die er von allen anderen Untergeben einforderte. Als Valentin auf die Forderung des Kaisers mit dem christlichen Bekenntnis antwortete, forderten die Anwesenden den Tod des Priesters. Claudius stand unter Druck. Er suchte einen Ausweg und ließ ihn einem Richter zuführen. Dieser forderte von dem Priester, dass er die Macht des in Jesus in die Welt gekommenen Lichtes beweise, indem er die erblindete Tochter des Richters sehend mache. Valentin zog sich ins Gebet zurück und bat Gott um eben dieses Zeichen. Tatsächlich wurde die Tochter des Richters sehend, in die ganze Familie der Geheilten ließ sich von Valentin taufen. Die Bekehrung des Richters aber brachte das Volk noch mehr gegen Valentin auf und setzte den Kaiser weiter unter Druck. Um sich auf dem Thron zu halten, sah Claudius keine andere Möglichkeit, als den alten Priester enthaupten zu lassen.
Soweit die Legende, die noch nicht erklärt, warum Valentin mit Blumen in Verbindung gebracht wird und wie er zum Patron der Liebenden werden konnte.
Hier dient eine andere Legende als Erklärung: Der Kaiser hatte den Befehl erlassen, dass die Soldaten, die unter ihm dienten, unverheiratet bleiben sollten, um sich ganz ihrem Dienst widmen zu können. Es war der Priester Valentin, der sich mutig und entschlossen diesem Befehl zuwider handelte, indem er auch Soldaten nach christlichem Christus vermählte. Als Geschenk soll der arme Priester all den frisch Vermählten Blumen aus seinem Garten mitgebracht haben. Die Legende schließt auch hier mit dem Hinweis, dass der Kaiser Valentin zur Strafe für seinen Widerstand hinrichten ließ.
Ob dies tatsächlich am 14. Februar geschehen ist, bleibt eine offene Frage. Vermutlich ist der Tag zum Tag der Erinnerung an Valentin einfach deshalb gewählt worden, weil er bereits einen Platz im öffentlichen Leben hatte. In Rom wurde um den 14.Februar ein Fruchtbarkeitsfest gefeiert. Es war wohl eine Art Initiationsritus, de dazu diente, junge Mädchen in die nächste Stufe, in die Ehe zu begleiten. Dazu gehörte, dass sie an diesem Tag heftig- auch mit Blumen-umworben wurde. Das Fest hatte also auch einen Wettkampfcharakter für die jungen Männer. Und der christlichen Welt schien es stimmig, die Erinnerung an den Blumen schenkenden Priester auf eben dieses Datum des Werbens und der Reifung zu legen.
In vielen Kirchengemeinden wird dieser Gedenktag gefeiert – als Tag der Liebe. Dabei geht aber mehr als um eine Romantik, die von der Blumen- und Schokoindustrie vermarket wird. Es geht um die Erinnerung an eine Liebe mit ganz anderen Facetten. Um eine Liebe, die tiefer und weiter reicht als die, die uns in der Werbung zum Valentinstag vorgestellt wird, die ganz auf den Grund reicht und ganz an den Anfang unserer selbst. Für diese Liebe setzt sich Valentin ein, weil er Christ ist und weil er diesen Glauben zeigt. Für ihn, den Pfarrer, ist die Liebe, die er unter den Menschen findet, die ihn erfreut, die er als Priester fördern und schützen möchte, ein Abglanz der Liebe Gottes, die in unsere Welt hineinreicht und sie wie ein Licht erwärmt. Valentin setzt sich deshalb für die Liebe ein, nicht weil er ein Romantiker ist, nicht aus atmosphärischen Gründen, sondern weil er weiß, dass ohne die Liebe alles Schaffen und Können, alles Denken und alle Kunst ohne Seele, ohne Leben wäre.
„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätten allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Lieb verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze.“
So schreibt Paulus im 1. Brief an die Korinther im 13. Kapitel. Dieser Text ist einer der bekanntesten und beliebtesten Texte unserer Bibel. Kaum ein Hochzeitspaar möchte ihn bei der eigenen Trauung missen. Denn die Liebe wird hier in den höchsten Ton gelobt und beschrieben:
„Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das ihr. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, die glaubt alles, die duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, so doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.“
Vielleicht hat Valentin diese Worte auch bei seinen Trauungen gelesen oder er hatte sie im Kopf, als er die Blumen überreicht hat.
Ganz sicher aber waren sie für ihn nicht nur auf die Stunde der Trauung reduziert und nicht nur für Paare reserviert. Denn wir wissen: die berühmten Worten aus dem 13. Kapitel, dem Hohenlied der Liebe, sind in Wirklichkeit gar kein Lied und erst nicht für Paare konzipiert, die sich das JA-Wort geben.
In diesem Briefabschnitt beschreibt der Apostel Paulus das Wesen Gottes. Es geht um die von Gott ausgehende und in Jesus Christus konkret gewordene Zuwendung Gottes zu jedem Einzelnen von uns. Um das, was unserem Leben die Grundlage, den Sinn und die Ausrichtung gibt. Um den Anfang, den Ursprung und um das Ziel eines gelingenden Lebens.
Um das JA Gottes, das alle romantischen Vorstellungen sprengt und gerade dort zu finden ist, wo unsere Vorstellungen von Liebe aufhören.
Darum geht es auch heute, wenn wir an Valentin und sein christliches Zeugnis erinnern: Nicht nur die Liebenden dürfen sich freuen, sondern wir alle dürfen uns als Geliebte erinnern und aus dieser Erinnerung neuen Mut und Hoffnung für unser Leben ziehen. Wir alle, die wir geliebt sind und dieses Gut besitzen – unabhängig davon, ob wir gerade eine Hoch-zeit menschlicher Begegnung erfahren oder das Gefühl haben, ein tiefes Tal durchschreiten zu müssen.
Denn auch diese Erfahrungen gehören zum Leben, das unter dem Vorzeichen der Liebeserklärung Gottes an uns steht: die Enttäuschung und die Unsicherheit, die Verletzbarkeit und die Trauer – über andere und über uns selbst.
Das sind die Erfahrungen, die in der Passionszeit Raum bekommen. Passion ist nicht die Kehrseite der Liebe. Ganz und gar nicht. Im Begriff der Passion steckt ja beides: Leiden und Leidenschaft. Es geht um den liebenden, um den leidenschaftlichen Einsatz Gottes für uns, für seine Geliebten.
Als Christen gehen wir in die Passionszeit mit dem Wissen darum, dass Jesus den Weg an Kreuz, in den Tod bewusst gegangen ist, um seine Botschaft der Liebe Gottes auch in die dunkelsten Stunden zu bringen. Um das JA Gottes mit dem NEIN der Welt zu konfrontieren. Auch das NEIN, das wir uns selbst oft zurufen. Um es zu überwinden und uns für das Leben neu zu öffnen und zu gewinnen. „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei: aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“
Diese Botschaft, mit der Paulus sein Kapitel schließt, ist, was wir uns alle heute in Erinnerung rufen dürfen, wenn wir selbst auf unser Leben blicken und auf die Liebeserfahrungen, die wir gemacht haben und die noch unerfüllt sind.
Und das ist es, wofür auch der heilige Valentin steht, der eben mehr ist als das, was die Konsumindustrie von ihm übriggelassen hat.
Pfarrerin Birgit Reichenbacher
Kolumne Januar 2019
„Suche Frieden und jage ihm nach“ – Jahreslosung aus Psalm 34,15
Ich gehe gerne in die Schule, auch als Lehrer wohlgemerkt. Für jede Stunde in der Starnberger Fachoberschule und im Gymnasium in Icking überlege ich mir, welches Ziel ich mit dem Unterricht konkret erreichen will. Der Lehrplan erwartet, dass ich mich dabei an den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler orientiere. Ähnlich hält es auch der Kollege, aus dessen Feder in der Bibel der 34. Psalm überliefert ist. Nach einem langen Dankgebet (in den Versen 2-11) hat er für uns (in den Versen 12-23) eine Lehrstunde in Sachen Weisheit parat.
Wie fängt man ein Thema an, von dem man als erfahrener Pädagoge erwartet, dass es die Schülerinnen und Schüler nicht von sich aus sofort anspricht? Der Kollege Psalmbeter beginnt mit einem damals üblichen Eröffnungsruf an die Schülerinnen und Schüler (Psalm 34,11). Dann nennt er in kluger Didaktik ganz am Anfang auch gleich das Thema der Stunde: es geht darum, uns zu einem Leben in Gottesfurcht hinzuführen. Diese Gottesfurcht soll aufnehmen, was unsere wahre Leidenschaft ist (34,13) und im Blick haben, mit welcher Haltung man am besten vor Gott lebt (34,14-15). In der anschließenden Erarbeitungsphase wird der Unterricht konkret, er beschreibt, welche Folgen eine solche Haltung in unserem Alltag dann haben wird (34,16-22). Eine Sicherungs-phase fehlt. Weil aber zu Beginn schon das Thema „Leben vor Gott“ anklang, ist sie womöglich dieses Mal entbehrlich. Zur Not muss das Thema eben erneut behandelt werden …
Auf die zentrale Frage, wie man im Leben glücklich wird, kann nur jeder Mensch seine eigene Antwort durch die Praxis geben, jeder verantwortungsbewusste „Lehrer“ wird da nur Hinweise geben. Das gilt allgemein, aber so natürlich auch für das junge Jahr 2019. Und dies sind die Hinweise des wei-sen Lehrers aus dem Psalm 34:
„Behüte deine Zunge vor Bösem
und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.
Lass ab vom Bösen und tue Gutes;
suche Frieden und jage ihm nach!“
Psalm 34,14-15
Im Einzelnen klingt das zunächst nicht originell, andere haben uns das auch schon gesagt. Glücklich im Leben wird, wer vorher bedenkt, was er sagt, und wer lieber auch einmal nicht sofort Widerworte gibt, auch wenn er Recht hat, die oftmals alles nur eskalieren – ein kluger Rat auch für alle, die heutzutage öffentlichkeitswirksam zu reden haben. Deeskalation schon in der Sprache wäre auch in Starnberg und Umgebung ein veritables Motto fürs neue Jahr ...
Glückliches Leben bedeutet zudem, so empfiehlt es uns der Weisheitslehrer der Bibel, möglichst viel Distanz zum Bösen suchen und auch zu halten - erfahrungsgemäß wird man sonst schneller in einen Strudel hineingezogen, als einem lieb ist. An dessen Ende zu oft ein Abgrund der Bosheit das Gute zu verschlucken droht …
Stattdessen sind wir aufgerufen, Gutes zu tun – und wir wissen ja, was gut ist, es ist uns gesagt und vertraut: „Hasst das Böse und liebt das Gute, richtet das Recht auf im Tor, vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaoth, gnädig sein dem Rest Josefs“ (Amos 5,15).
Und überhaupt sollten den vor allem Frieden suchen. Und, wenn wir ihn erkannt haben, müssen wir den Frieden ihn haschen, sollen ihm nachjagen, können diesen flüchtigen Genossen wie einen Hasen jagen und ihm auch sonst in allem nachlaufen und nachstreben. Erlegen werden wir ihn eh‘ nicht, dass sei allen biblischen Tierschützern versprochen. Es wäre schon gut, wenn wir uns zu seinen Spießgesellen machen würden.
Der Frieden als Anführer unseres Zuges durch das Jahr, das soll die Losung für 2019 sein.
Pfarrer Dr. Stefan Koch

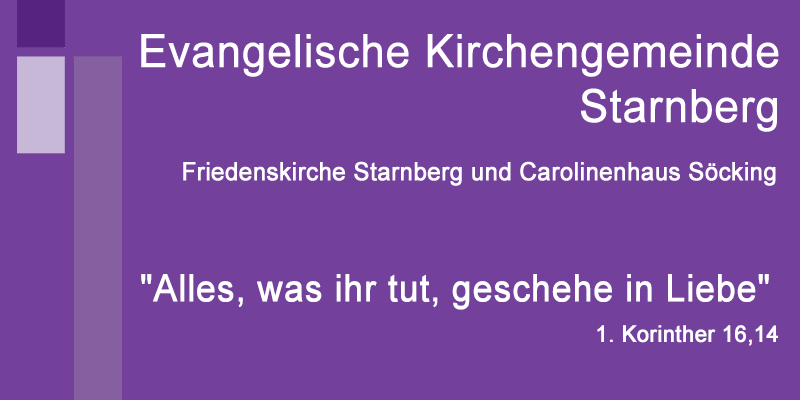




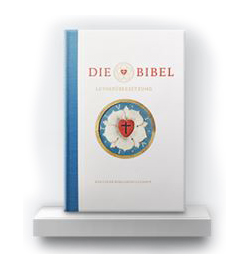


 Der frühere Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, hat in einer Predigt in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin das Pfingstfest einmal mit der Erfahrung der Schubumkehr verglichen. Schubumkehr – das ist die Umkehr der Kraft, die ein Flugzeug zu leisten hat, wenn es zum Anflug ansetzt. Wenn die Beschleunigung in eine Bremskraft verwandelt wird.
Der frühere Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, hat in einer Predigt in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin das Pfingstfest einmal mit der Erfahrung der Schubumkehr verglichen. Schubumkehr – das ist die Umkehr der Kraft, die ein Flugzeug zu leisten hat, wenn es zum Anflug ansetzt. Wenn die Beschleunigung in eine Bremskraft verwandelt wird.  Die Chance der Stille
Die Chance der Stille Zum Valentinstag
Zum Valentinstag







